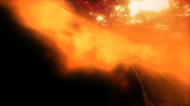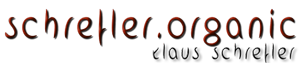
| organic fusion of light and darkness |

|
Betrachtung - Werner Mandlberger |
|
„Wie kann einer sich bergen vor dem, was nimmer untergeht?“ 1 Klaus Schrefler scheint sich die Frage aus diesem Fragment Heraklits nie gestellt zu haben - er hat vielmehr mit dem „ immerdar Aufgehenden, das dem Verbergen seine Gunst schenkt “ 2 einen Pakt geschlossen. Einen Pakt im Sinne von einem totalen Einverständnis mit den Erscheinungen 3, das ihn sozusagen selbst zum Ort ihrer Dramaturgie 4werden lässt, indem er sich nicht einer Form von Dialektik verschreibt, sondern einem Einrollen der Welt in sich selbst 5. Sein steinerner Ouroboros bringt eine Welt zum Vorschein, in der die Zeit das Werden selbst ist, mit Friedrich Nietzsches Worten „ein Ungeheuer von Kraft, ohne Anfang ohne Ende, ein Haushalt ohne Ausgaben und Einbußen, ein Meer in sich selber stürmender und flutender Kräfte, ewig sich wandelnd, ewig zurücklaufend, mit ungeheuren Jahren der Wiederkehr, als ein Werden, das kein Sattwerden, keinen Überdruß, keine Müdigkeit kennt“ 6. Eine Welt, in der nicht der Zufall rückblickend den Ereignissen eingeimpft 7wird, um den Eindruck zu erwecken, sie hätten auch ganz anders verlaufen können. Keine Spur der Domestizierung dieses grausamen Aspekts der Notwendigkeit 8mit Hilfe der Kausalität und des Impfstoffes Zufall, um auch vorausblickend den Eindruck zu erwecken, wir würden die Welt wirklich beherrschen. Sondern eine Welt, die nur (und dieses nur ist alles) aus Wirkungen besteht und in der nie „plötzlich dieser Bodensatz, diese beliebige, statistische, zufällige Wirklichkeit auftaucht“ 9, denn „in der primitiven Organisation, und wahrscheinlich auch in unserer Tiefenmentalität, gibt es keinen Zufall und auch kein beliebiges – alles ist gewollt und Effekt eines Willens (was offensichtlich ein wesentlich spannenderes Universum ergibt, als das, das durch Ursachen oder Wahrscheinlichkeiten regiert wird)“ 10. Klaus Schrefler zeigt durch sein Werk auf ein großes Spiel der Formen, ein großes Spiel des Werdens 11 im Sinne Heraklits, in welchem das ewig lebendige Feuer spielt, weil es spielt: „Die Weltzeit – ein Kind ist sie, ein spielendes, her und hin die Brettsteine setzend, eines [solchen] Kindes ist die Herrschaft.“ 12 „Das „Weil“ versinkt im Spiel. Das Spiel ist ohne „Warum“. Es spielt, dieweil es spielt. Es bleibt nur Spiel: Das Höchste und das Tiefste“13. Ein Werden und Vergehen wie Nietzsche14 es sich in Bezug auf Heraklit dachte, ein Bauen und Zerstören in ewig gleicher Unschuld, wie es in dieser Welt nur das Spiel des Künstlers und des Kindes hat, und in dem immer nach einem Augenblick der Sättigung der neu erwachende Spieltrieb andere Welten ins Leben ruft. „Dieser Kosmos hier, sofern er derselbe für alles und für alle ist, keiner der Götter, auch nicht einer der Menschen hat ihn hervorgebracht, der schon immer war und der ist und sein wird: unerschöpflich lebendiges Feuer…“15 1 Ivo de Gennaro, Logos- Heidegger liest Heraklit. Berlin 2001. S. 132 2 Ebda. S. 142 3 Jean Baudrillard, Enrique Valiente Noailles, Gesprächsflüchtlinge. Wien 2007 S. 33 4 Ebda. 5 Ebda. 6 Friedrich Nietzsche, Der Wille zur Macht. Stuttgart 1996. S. 697 7 Jean Baudrillard, Enrique Valiente Noailes, Gesprächsflüchtlinge. Wien 2007 S. 65 8 Ebda. 9 Ebda. S. 64 10 Jean Baudrillard, Enrique Valiente Noailes, Gesprächsflüchtlinge. Wien 2007 S. 64 11 Ebda. S. 58 12 Ivo de Gennaro, Logos- Heidegger liest Heraklit. Berlin 2001. S. 162 13 Ivo de Gennaro, Logos- Heidegger liest Heraklit. Berlin 2001. S. 188 14 Friedrich Nietzsche, Die Philosophie im tragischen Zeitalter der Griechen 15 Ivo de Gennaro, Logos- Heidegger liest Heraklit. Berlin 2001. S. 162 |
uni-graz Naturpark Sölktäler INTI - world art das 'world art' projekt / ein lebenszyklus
|
(Original altgriech.: "τὸ ἀντίξουν συμφέρον καὶ ἐκ τῶν διαφερόντων καλλίστην ἁρμονίαν […] γίνεσθαι.")
Visual Media Art |